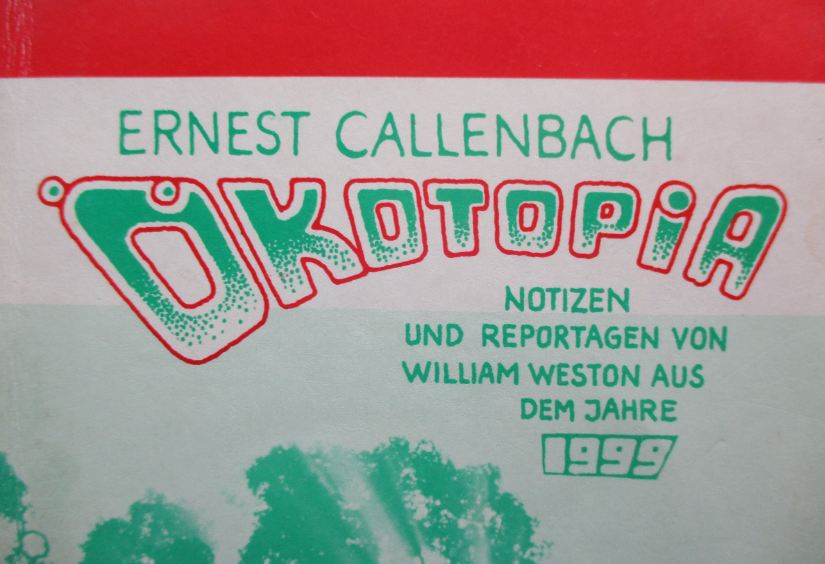
Das Buch „Ökotopia“ von Ernest Callenbach trägt den Untertitel „Notizen und Reportagen von William Weston aus dem Jahre 1999“ und ist im englischen Original 1975 erschienen. Die (west-)deutsche Ausgabe erschien 1978.
In dem Buch wird eine ökologische Utopie beschrieben. Die Handlung spielt in der damaligen Zukunft, nämlich im Jahr 1999. Zwanzig Jahre nach der Abspaltung des US-Nordwestens (Nordkalifornien, Oregon, Washington) betritt der US-Reporter William Weston den unabhängigen Staat „Ökotopia“. Nach einem geplanten Bevölkerungsrückung leben hier 14 Millionen Menschen. Unter der regierenden „Survivalist Party“ wurde ein neues und ‚ökotopisches‘ Gesellschaftsmodell entwickelt.
Es wird nur noch mit Pfeil und Bogen gejagt, Kunststoff ist verboten, das Verpackungs-Problem ist damit gelöst, man lebt autofrei und es gibt in vielen Orten einen „Grundbedarfsladen“.
Der Konsum von Marihuana ist legalisiert – damals noch eine Utopie: „Eines der gewagtesten Experimente der neuen Regierung bestand ja darin, Marihuana ausdrücklich zu einem gewöhnlichen Genußmittel zu erklären. Man hob nicht nur das gesetzliche Verbot auf, sondern verteilte sogar kostenlosen Samen bester Qualität im Rahmen einer Kampagne, die den »selbstgemachten Joint« fördern sollte. Das Ergebnis war, daß jedes Haus, jede Wohnung im eigenen Garten oder im Blumenkasten Hanf anpflanzen kann. Es ist, als hätten wir bei uns in der Küche einen Freibier-Hahn.“ (Seite 215)
Auch in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit ist man egalitär: „In vielen dieser Familien teilt man sich nicht nur die Versorgungs- und Haushaltspflichten, sondern auch die Kindererziehung; dabei scheinen Männer und Frauen zwar gleich viel Zeit zu investieren, jedoch in einer eigentümlichen Verteilung der Befugnisse. Allgemein hat sich die Gleichberechtigung im ökotopianischen Leben in erstaunlichem Maße durchgesetzt – Frauen üben verantwortliche Berufe aus, erhalten gleiche Bezahlung und bestimmen nicht zuletzt den Kurs der Survivalist Party.“ (Seite 87-88)
Um einen – vom Autoren anscheinend als notwendig angesehene – Triebabfuhr anzubieten gibt es Kriegsspiele von jungen Männern, bei denen es 50 Tote pro Jahr gibt.
Die Wirtschaft ist dezentralisiert und in Teilen wird eine ‚Waldgesellschaft‘ beschrieben. Jede Bürgerin und jeder Bürger muss z.B. einen „Walddienst“ ableisten, um Bauholz zu erhalten
Es gibt ein Vererbungsverbot, es herrscht die 20-Stunden-Woche und es gibt eine Arbeiterselbstverwaltung. Außerdem herrscht untereinander eine offene Zärtlichkeit.
Die herrschende Ökoreligiösität ist für unreligiöse Leser*innen allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.
Leider tragen Teile der Utopie aus kritischer Sicht reaktionäre Züge. Der Autor schildert eine nämlich auch eine Art Apartheid. Innerhalb von Ökotopia gibt es Ethnostaaten. Der Journalist Peter Bier kritisiert diese ethnopluralistische Utopie zu Recht: „Stattdessen skizziert Callenbach eine Struktur, die an das politische System Südafrikas mit den Homelands erinnert. Ökotopia ist ein Apartheidsstaat: Stadtviertel mit überwiegend schwarzer Bevölkerung oder ehemalige Chinatowns bilden eigene Ministaaten. Dazu gibt es ein größeres Gebiet namens ‚Soul-City‘ für Schwarze, was an das Klischee erinnert, Schwarze seien besonders begabt für Musik und Tanz. Für Lateinamerikaner_innen ist in Ökotopia ebenfalls ein eigener Staat geplant, allerdings müssen noch Umsiedlungen vorgenommen werden.“
(Peter Bierl: Grüne Braune. Umwelt-, Tier- und Heimatschutz von rechts, Münster 2014, Seite 67-68)
Dem Buch insgesamt attestiert Bierl zu Recht eine „krude Mischung aus emanzipatorischen und rechten Vorstellungen“ zu beinhalten.
Literarisch ist das Buch eher eine Art Zweck-Roman und damit keine Feinkost. Die Handlung dient der Darstellung der Utopie des Autors.
Bei gebotener kritischer Distanz lässt sich diese Öko-Utopie aus dem vordigitalen Zeitalter aber trotzdem lesen.
Sie ist allerdings nur noch antiquarisch erhältlich.
Ernest Callenbach: Ökotopia. Notizen und Reportagen von William Weston aus dem Jahre 1999, Berlin 1984.
