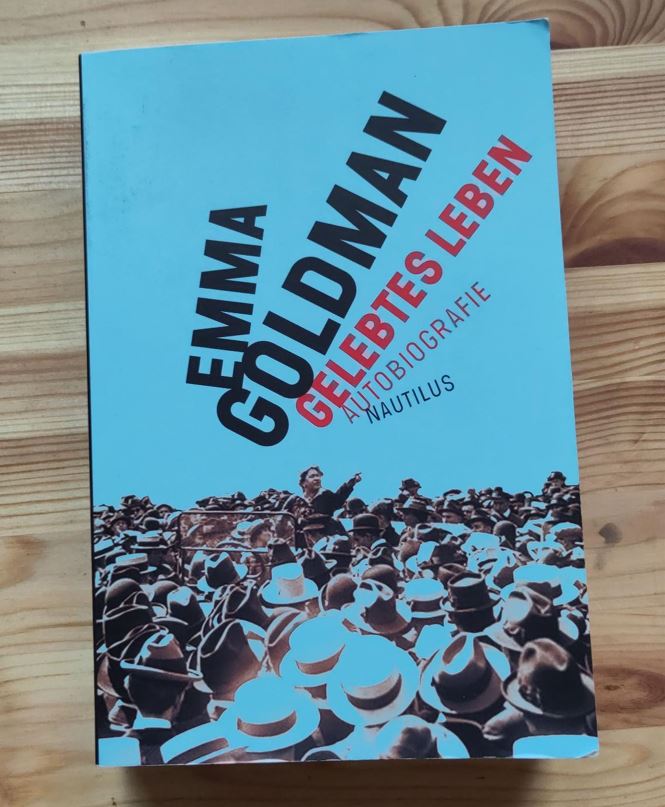
Die 1931 im englischen Original erschienene Autobiografie mit dem Titel „Gelebtes Leben“ (Originaltitel „Living My Life“) der Anarchistin Emma Goldman (1869-1940) ist über 900 Seiten dick, aber jede Seite lohnt sich.
Erwachen und Lehrjahre einer Anarchistin
Goldman wuchs in Kaunas (heute Litauen, damals Russland) und in Königsberg (damals Deutschland) auf. Ab dem 13. Lebensjahr lebte sie in St. Petersburg. Im Buch berichtet offen über die schwierige Kindheit, u.a. durch die Schläge von ihrem Vater.
Im Alter von 17 Jahren übersiedelte sie 1885 in die USA zu ihrer Schwester nach Rochester (New York). Hier heiratete sie, aber die Ehe scheiterte schnell.
Goldmans politisches Erweckungserlebnis ist die Hinrichtung von vier Anarchisten im Dezember 1887, denen die Behörden ohne Beweise einen Bombenanschlag am 4. Mai 1886 auf dem Haymarket in Chicago in die Schuhe geschoben hatten.
Die 17-jährige Goldman ist wie viele andere empört über den „Justizmord an Anarchisten“ und wird selber zur Anarchistin. Allerdings geht es ihr nicht nur um graue Theorie sondern auch um Praxis und Reflexion verinnerlichter Normen und Zwänge: „Für mich war der Anarchismus nicht bloß eine Theorie für eine ferne Zukunft, er war ein lebendiger Versuch, uns von inneren wie äußeren Verboten und den zerstörerischen Schranken zu befreien, die die Menschen voneinander zu trennen.“ (Seite 510-11)
Goldman ist jung und will das Leben genießen. Der berühmte Spruch „Wenn ich nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution!“ taucht in dem Buch zwar nirgendwo wortwörtlich auf, aber an einer Stelle im Buch schildert sie eine dazu passende Szene: „Eines Abends nahm mich ein junger Vetter von Sascha beiseite. Mit ernster Miene, so als wollte er den Tod eines teuren Genossen bekannt geben, flüsterte er mir zu, dass es sich für einen Agitator nicht gehörte zu tanzen. Jedenfalls nicht so unbekümmert und überschwänglich. Es wäre unwürdig für jemanden, der eine treibende Kraft in der anarchistischen Bewegung werden wollte. Meine Leichtigkeit schadete der Bewegung.
Die schamlose Einmischung des Jungen machte mich wütend. Ich sagte, er sollte sich um seine eigene Angelegenheiten kümmern, ich wäre es leid, ständig die Sache vorgehalten zu bekommen. Ich konnte nicht glauben, dass eine Sache, die für ein Ideal stand, für Anarchie, für Zufriedenheit und Freiheit von Konventionen und Vorurteilen, die Verleugnung des Lebens und der Freude fordern könnte.“ (Seite 63)
Im Jahr 1889 geht sie nach New York. Die anarchistische Szene in New York sammelte sich damals um die Blätter „Freiheit“ und „Autonomie“ herum, in Stamm-Kneipen und in kleinen Gruppen. Die Szene ist vor allem in den deutschen, russischen und jüdisch-jiddischsprachigen Einwanderer-Milieus verwurzelt. Das Blatt „Freiheit“ wurde von dem, aus Deutschland stammenden, Anarchisten Johann Most (1846-1906) herausgegeben. Most wird zu Goldmans Förderer und Lehrmeister. Doch Most will Goldman besitzen und ein Kind von ihr. Aber Goldman war eine selbstbewusste und selbstständige Frau, die sich gegen eine Mutter-Rolle entschied, obwohl sie Kinder mochte: „Immer mehr war ich zu der Überzeugung gekommen, dass es in meinem Leben keine lange harmonische Liebe geben würde, nicht Frieden, sondern Kampf würde mein Schicksal sein. In einem solchen Leben war kein Platz für ein Kind.“ (Seite 180)
Sie weist Most also ab und dieser reagiert mit Eifersucht und Hass. Er äußert sich sogar immer wieder antisemitisch, wie Goldman entsetzt fest stellen muss.
Emma reagiert resolut auf ihre Weise auf den Hass von Most: Sie peitscht ihn in der Öffentlichkeit aus.
Anfangs beschreibt Goldman noch einen naiven Glauben an die Propaganda der Tat, auch durch Attentate. Offen und ehrlich beschreibt sie wie sie mit ihrem Mitstreiter Alexander „Sascha“ Berkman (1870-1936), den sie 1889 kennen lernte, im Jahr 1892 einen Bombenanschlag auf einen Fabrik-Besitzer plante, der bei Arbeitskämpfen zehn Tote und 60 Verletzte zu verantworten hatte. Als es mit der Bombe nicht klappt, versucht Berkman als Einzelner den Industriellen zu erschießen, verletzt ihn aber nur. Dafür wird er zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, kommt aber 1906 nach 14 Jahren frei. Goldman hält ihm über die Gefängnismauern die Treue. Trotz gewisser Konflikte bleiben sie politische Verbündete.
Im Jahr 1895 geht sie für eine Ausbildung nach Europa (London, Wien). In England trifft sie erstmals Kropotkin und in Wien besucht sie die Vorlesungen von Sigmund Freud.
In Wien macht sie eine Ausbildung zur Geburtshelferin und als solche arbeitet sie nach ihrer Rückkehr, vor allem für arme Familien. Zwischendurch verdient sie ihren Lebensunterhalt auch als Masseurin oder Managerin einer russischen Theatertruppe
Schlussendlich verdient sie aber ihr Geld vor allem durch ihre Tätigkeit als Rednerin und Publizistin. Dabei ist sie in Bezug auf ihre Themen variantenreich. In ihren Reden behandelt sie neben Anarchismus Themen wie Gefängnisse, Atheismus, Redefreiheit, Erziehung, Ehe und freie Liebe, Militarismus und Wehrpflicht, Sexualaufklärung und Geburtenkontrolle und Homosexualität, aber auch mit Dramen wie „Ein Volksfeind“ von Schriftstellers Henrik Ibsen beschäftigt sie sich.
Ab 1906 gab sie mit Anderen die Zeitschrift „Mother Earth“ heraus, die 1917 verboten wurde.
Goldmann tritt zunehmend als Agitatorin auf. Damit gerät sie in den Fokus der bürgerlichen Presse, die oft Hass-Kampagnen gegen die „rote Emma“ führen. Erst das persönliche Zusammentreffen belehrt manche eines besseren: „Dank des Polizeiknüppels hatten sie gemerkt, dass Emma Goldman weder eine Attentäterin noch eine Hexe noch ein Sonderling war, sondern eine Frau, die wegen ihres sozialen Ideals von den Behörden unterdrückt wurde.“ (Seite 419)
Ständig wird sie mit Attentaten in Verbindung gebracht, mit denen sie nichts zu tun hat. Ein „Criminal Anarchy Law“ versucht die gesamte anarchistische Bewegung zu kriminalisieren. Sie wird unzählige Male verhaftet und einmal von einer Bürgerwehr in San Diego fast gelyncht.
Zwar wird Emma Goldman immer wieder das Opfer von Repression und Volksmob, aber das in den USA verbreitete Ideal der freien Rede führt dazu, dass sie auch von Pfarrern oder Professoren eingeladen wird, die keine Anarchisten sind sich aber ihre Reden anhören möchten.
Privat versucht sie das Ideal der freien Liebe zu leben, beschreibt aber immer wieder ehrlich wie sie an diesem Ideal scheitert. Offen schreibt sie über ihre Gefühle gegenüber verschiedenen Männer und ehrlich schildert sie verschiedene Liebschaften. Einen Teil ihrer Beziehungen zu Männern würde man heute wohl als ‚toxisch‘ beschreiben.
Goldsteins Autobiografie erzählt von vielen, inzwischen vergessenen, Kämpfen der Arbeiter*innen-Bewegung in den Vereinigten Staaten. Ihre Erzählungen erinnern auch daran wie korrupt und brutal die US-Demokratie damals war, in der fortwährend Arbeiter*innen ermordet wurden – nicht zu vergessen die Morde an Schwarzen, auch wenn Goldstein diese nur am Rande erwähnt. Hinzu kommen mehrere Justizmorde.
Im Gegensatz zu anderen jüdischen Linken verleugnet Goldman ihre jüdische Herkunft nicht, sondern bekennt sich offen zu ihr: „Mein Leben war mit dem der Juden verknüpft. Ihr geistiges Erbe war das meine, und ihre Werte war in meine Existenz eingegangen. Der ewige Kampf der Menschheit war tief in mir verwurzelt.“ (Seite 634)
Das Buch erzählt deswegen auch die Geschichte der jüdischen Arbeiter*innen-Bewegung in den Vereinigten Staaten. Sie schreibt etwa über jüdisch-proletarische Organisationen wie die Gewerkschaft „United Hebrew Trades“ (Jiddisch: „Fareynikte Yidishe Geverkshaftn“) oder die „Jewish Socialist Party“ in den USA. Ebenso schreibt sie aber auch über die jüdische Arbeiter*innen-Bewegung im Londoner Eastend, wo ein nichtjüdischer deutscher Anarchist diese Bewegung zu organisieren versuchte: „Der führende Kopf der Arbeit im East End war Rudolf Rocker, ein junger Deutscher, der das besondere Phänomen eines nichtjüdischen Herausgebers einer jiddischen Zeitung darstellte.“ (Seite 238)
Zerstörte Hoffnungen: Emma Goldman in der jungen Sowjetunion
Mit der Februar-Revolution 1917 blicken alle revolutionären Linken nach Russland, so auch Emma Goldman, die noch dazu aus Russland kommt: „Unerwartet brach ein Hoffnungsschimmer aus dem Osten hervor. Er kam aus Russland, dem Land der jahrhundertealten Zarenherrschaft. Der lang ersehnte Augenblick war gekommen – die Revolution!“ (Seite 542)
Ein paar Monate später folgt der als ‚Oktoberrevolution‘ verklärte Putsch der Bolschewisten unter Lenin gegen die sozialistisch-liberale Provisorische Regierung.
Goldman wird aus der Ferne eine Anhängerin der Bolschewiki und verteidigt deren Machtübernahme gegen die Anwürfe und Kritik.
Gleichzeitig traten die USA Anfang April 1917 auf Seiten der Entente in den Ersten Weltkrieg ein. Hurra-Patriotimus und militärische Mobilisierung grassieren im Land:
„Über das ganze Land verbreitete sich der Wahnsinn des Patriotismus.“ (Seite 585)
Ihr Radikal-Pazifismus immunisiert Goldman gegen diesen Sirenen-Gesang. Die Anarchist*innen wenden sich gegen die Kriegsbeteiligung, allerdings nicht alle. Goldman berichtet enttäuscht; dass ihr Vorbild Peter Kropotkin sich auf die Seite der Entente und gegen den preußisch-deutschen Militarismus stellte. Trotz dieser Kontroverse bricht sie aber nicht mit Kropotkin. Schon länger hatten Goldman und Berkman über eine Rückkehr nach Russland nachgedacht, um sich hier der Revolution anzuschließen. Die US-Behörden kommen ihrer Entscheidung zuvor, indem sie die beiden aus Russland stammenden Ausländer einfach nach Russland deportieren lassen. Die beiden werden am 21. Dezember 1919 auf Basis des „Anarchist Exclusion Act“ ausgewiesen und leben von Januar 1920 bis Dezember 1921 in der „Diktatur des Proletariats“. In der Abschiebe-Haft schreiben die beiden einen Abschiedsbrief an ihre Freund*innen: „Seid guten Mutes, Freunde und Genossen. Wir gehen leichten Herzens ins Gefängnis. Für uns ist es befriedigender, hinter Gittern zu sein, als frei mit einem Maulkorb zu leben. Unser Geist wird wird nicht entmutigt, unser Wille nicht gebrochen werden. Wir kehren zur rechten Zeit an unsere Arbeit zurück.
Dies ist unser Abschied von euch. Das Licht der Freiheit brennt heutzutage schwach. Aber verzweifelt nicht, Freunde. Haltet den Funken am Leben. Die Nacht kann nicht ewig dauern. Bald gibt es Risse in der Dunkelheit, und der Neue Tag wird auch in diesem Land anbrechen.
Möge jeder von uns fühlen, dass wir unser Scherflein zum großen Erwachen beitragen.
Emma Goldman, Alexander Berkman“ (Seite 594)
In Russland angekommen folgt schnell eine erste Ernüchterung. Doch lange versuchen Berkman und Goldman Ausreden und Erklärungen für die „Schandflecken, die so geschickt unter kommunistischer Schminke versteckt werden“ (Seite 673), zu finden. Am Anfang ist es die Blockade Sowjetrusslands und die Angriffe der Konterrevolution, die sie als Erklärung für staats-kommunistische Autokratie, Repression und Bürokratie bemühen.
Ihre Prominenz im Ausland sichert den beiden eine gewisse Sicherheit während einheimische Anarchist*innen bereits verfolgt, inhaftiert und erschossen werden. Aus heutiger Perspektive mutet es etwas seltsam an, dass die beiden trotz ihres Wissens über Massenhinrichtungen und Verfolgungen durch die „Tscheka“ (Geheimpolizei) so lange in ihren Zweifeln verharren und nicht früher endgültig mit dem autoritären Regime Lenins brechen. Dabei wird ihnen in Gesprächen mit Vertreter*innen des Sowjet-Regimes recht schnell deutlich deren menschenverachtende Perspektive klar.
Erschreckt stellt Goldman fest dass der berühmte Schriftsteller Maxim Gorki auf die russische Bevölkerung von oben herab schaut und über die einfache Bevölkerung als kulturlos, primitiv und barbarisch beschimpft. Sie zitiert Gorki mit folgenden Worten: „Ein Hundertmillionenvolk von grausamen Wilden, die mit barbarischen Methoden an der Leine gehalten werden müssen.“ (Seite 679)
Auch Lenin plädiert nach Goldmans Schilderung deutlich für ein autoritäres Handeln: „Im gegenwärtige Stadium sei alles Geschwätz über Freiheit in Russland nur ein Fressen für die Reaktion, die Russland in die Knie zu zwingen sucht. Nur Banditen würden sich dessen schuldig machen, und sie müssten hinter Schloss und Riegel gehalten werden.“ (Seite 699)
Mit diesen „Banditen“ meinte Lenin die Anarchist*innen, die sich nicht dem Allmachtanspruch der Bolschewiki unterworfen hatten. Kritik diffamiert Lenin als „bourgeoise Sentimentalität“, von der man sich frei zu machen habe. Dabei waren die Anarchist*innen in einem grundsätzlichen Dilemma gefangen: „Vor allem die Anarchisten säßen säßen zwischen den Stühlen. Weder konnten sie mit der furchtbaren Macht im Kreml Frieden schließen, noch konnten sie den Feinden Russlands die Hand reichen.“ (Seite 703-704)
Die Sowjet-Macht verfolgte Anarchist*innen, unterdrückte die Landbevölkerung, etablierte eine Günstlingswirtschaft für Partei-Genoss*innen und unterdrückte überhaupt alle Arten von Abweichungen. Goldman beschreibt zum Beispiel Razzien gegen Schwarzmärkte, die die Ärmsten in den Städten treffen. Selbst der berühmte Peter Kropotkin muss isoliert unter Hunger leiden.
Die Militarisierung der Arbeit, die Bürokratie und der Zentralismus erstickten jede Eigeninitiative und Kreativität.
Berkman und Goldman suchen sich eine Nische, in der sie relativ unabhängig sein können. Sie werden Teil eines Teams des Revolutionsmuseums in Petrovgrad, welches für das Museum wichtige Zeitdokumente im europäischen Teil Russlands zusammen trägt. Auf diesen Expeditionen stoßen die beiden in der Ukraine auch auf die Überlebenden eines antisemitischen Pogroms. Goldman erkennt: Viele Mitglieder der jüdischen Gemeinden Anhänger sind Anhänger der Sowjet-Regierung, weil diese tatsächlich anti-antisemitisch eingestellt ist und die mörderischen Pogrome verhindert.
Doch nach ihrer Rückkehr nach Petrovgrad (St. Petersburg / ab 1924: Leningrad) werden ihre letzten Hoffnungen auf die Oktoberrevolution in Blut ertränkt. Gemeint ist ein Streik in Petrovgrad, dem sich die Matrosen in Kronstadt im März 1921 anschließen. Dieser ‚Aufstand‘ wird von Lenin und Trotzki blutig niedergeschlagen.
Später stellen die beiden zudem entsetzt fest wie der antisemitische weiße General Slatschow-Krimski 1921 die Seiten wechselt, zu den Bolschewiki überläuft und von diesen zur Aufstandsbekämpfung eingesetzt wird.
Obwohl Berkman und Goldman selber lange Lenins Lug und Trug erlagen, beobachten sie wie internationale Delegationen von Arbeiter*innen-Bewegungen rund um den Globus nach Moskau kommen und dort getäuscht werden oder sich bewusst täuschen lassen: „Sowjetrussland war zum modernen sozialistischen Lourdes geworden. Blinde und Lahme, Taube und Stumme strömten dorthin, um die Wunderheilungen zu erleben.“ (Seite 835)
Ende 1921 verlassen Goldman und Berkman Russland und warnen Linke vor der bolschewistischen Diktatur. Viele staatsgläubigen Linken feinden sie für ihre libertäre Kritik am Bolschewismus an.
Wahrlich ein gelebtes Leben
Gerade am Anfang ihrer anarchistischen Laufbahn ist Goldman in ihrem Buch noch sehr pathetisch, im Laufe ihres Lebens kommt mehr Realismus dazu. Doch in vielem bleibt sie kompromisslos und konsequent, eine Idealistin bis zum Schluss.
Goldman beendet ihre Autobiografie mit den folgenden zwei Sätzen: „Mein Leben – ich hatte es gelebt mit seinen Höhen und Tiefen, in bitterer Trübsal und jauchzender Freude, in schwarzer Verzweiflung und fiebernder Hoffnung. Ich hatte den Kelch bis zum letzten Tropfen geleert. Ich hatte mein Leben gelebt.“ (Seite 905)
Sie ist auch nach dem Buch weiter konsequent geblieben. Sie blieb politisch aktiv und engagierte sich für das revolutionäre Spanien gegen den Franco-Faschismus.
Emma Goldman starb am 14. Mai 1940 in Toronto, Kanada. Das heißt der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und die Vernichtung des größten Teil des europäischen Judentums, aus dem sie kam und zu dem sie sich bekannte, blieben ihr glücklicherweise erspart.
Ihre Autobiografie verdient die Lektüre aller, die sich für Zeit-, linke Bewegungs-, Frauen-, jüdische und anarchistische Geschichte interessieren.
Emma Goldman: Gelebtes Leben, Hamburg, 3. Auflage 2018 (Original: 1931)
