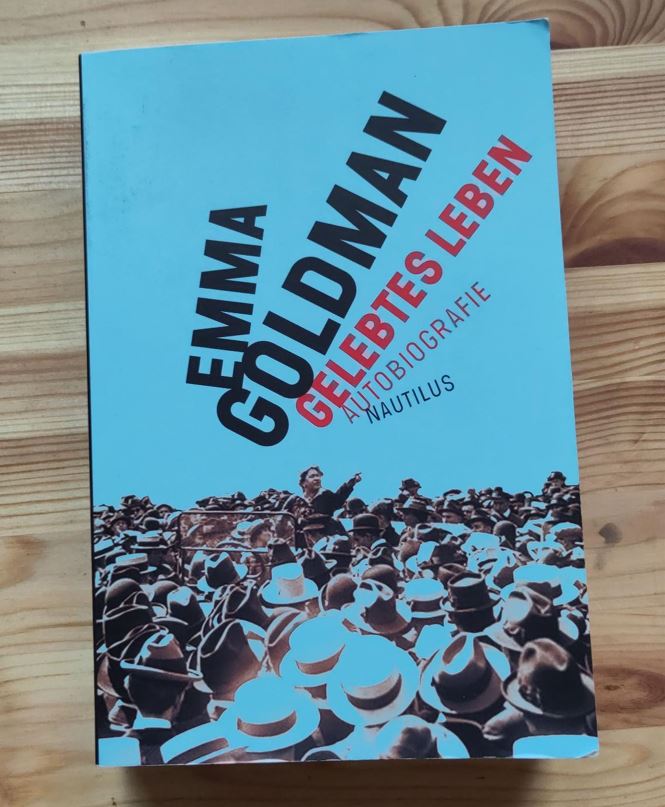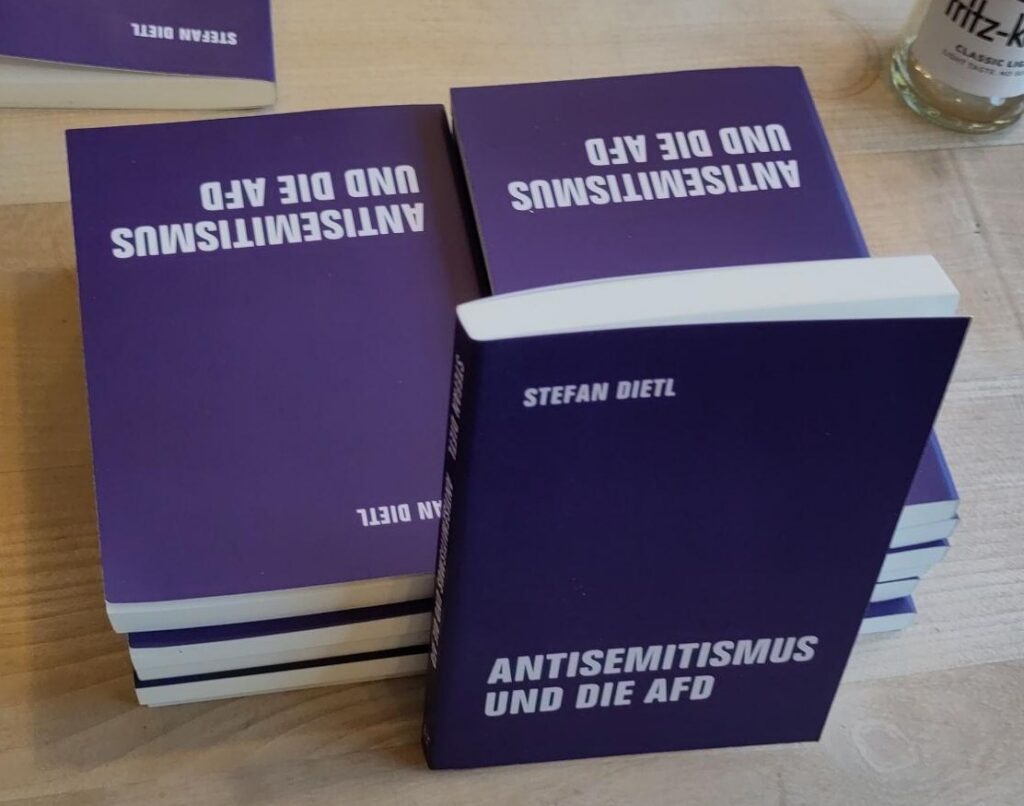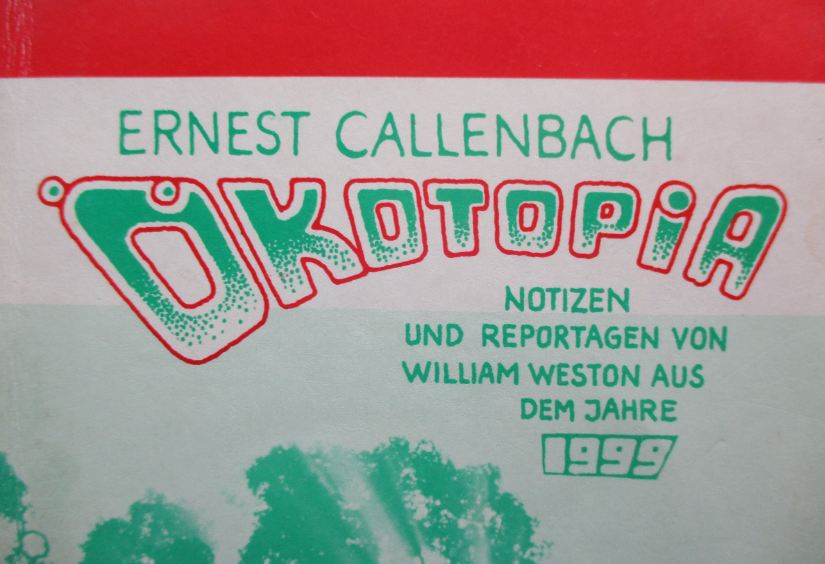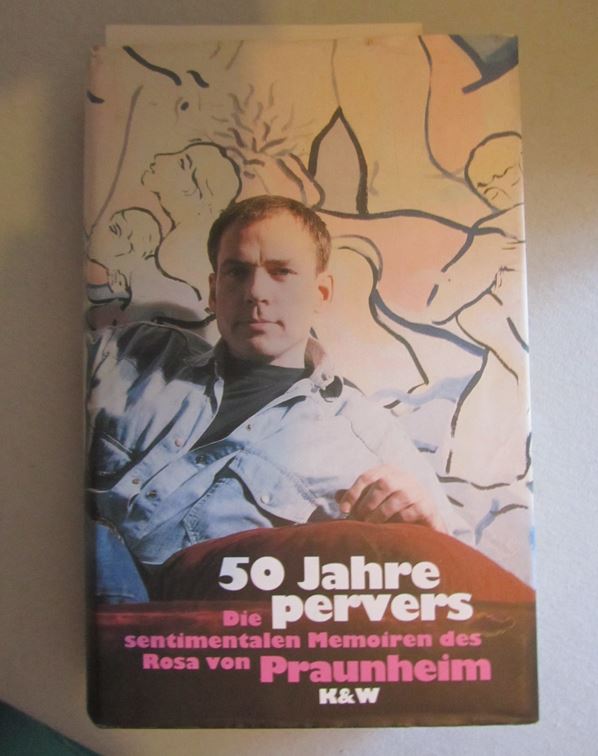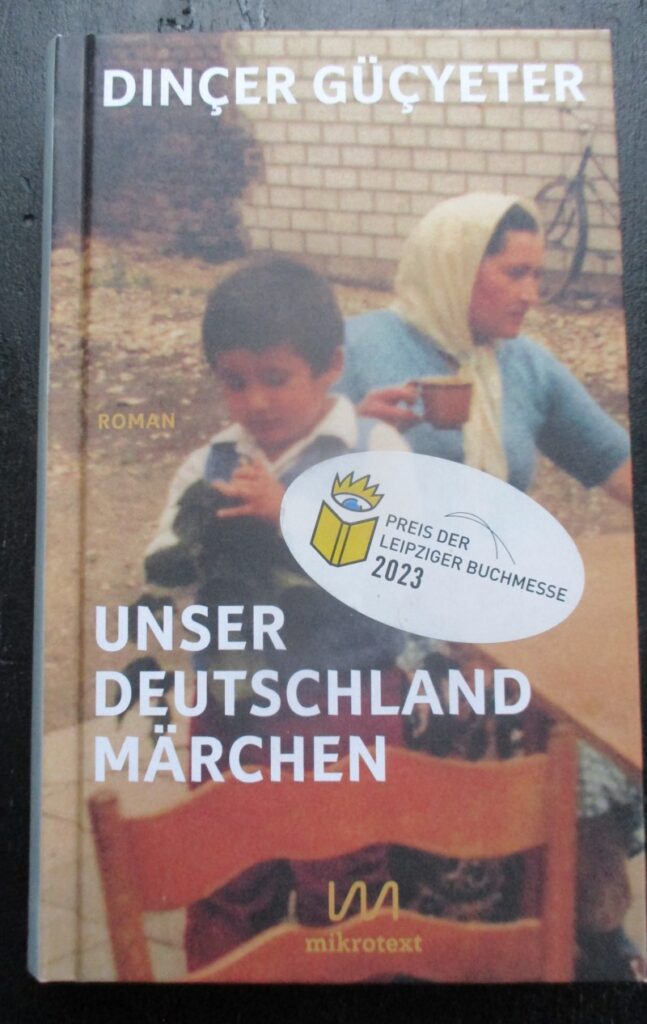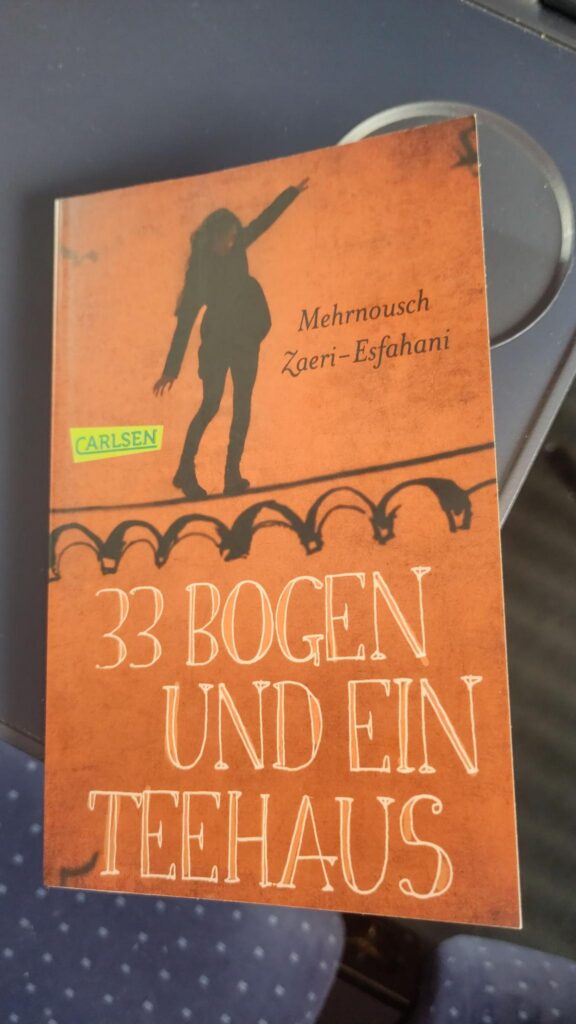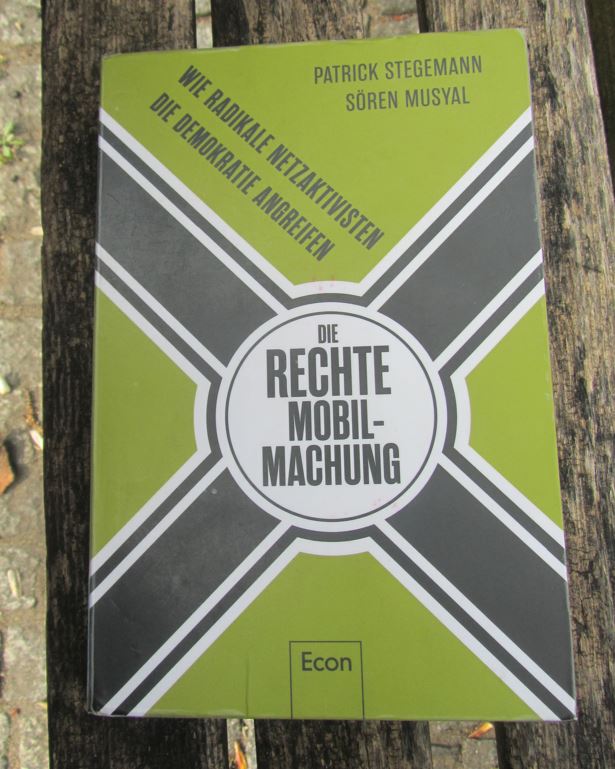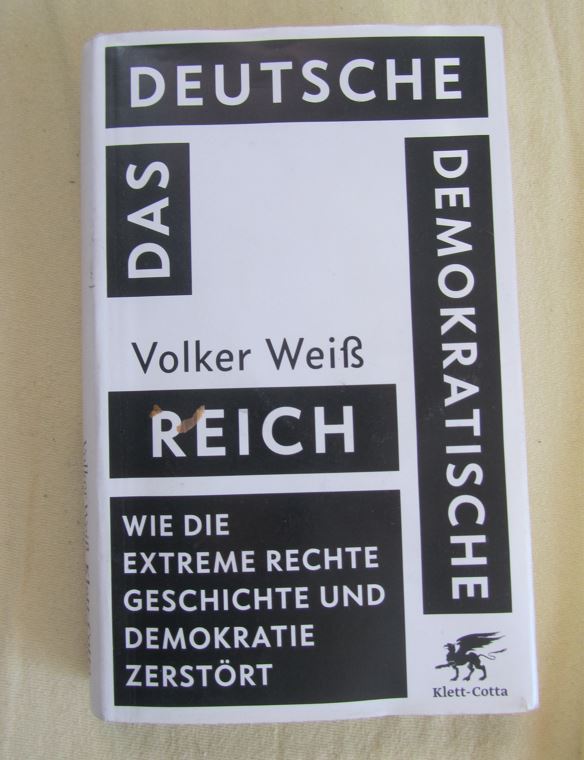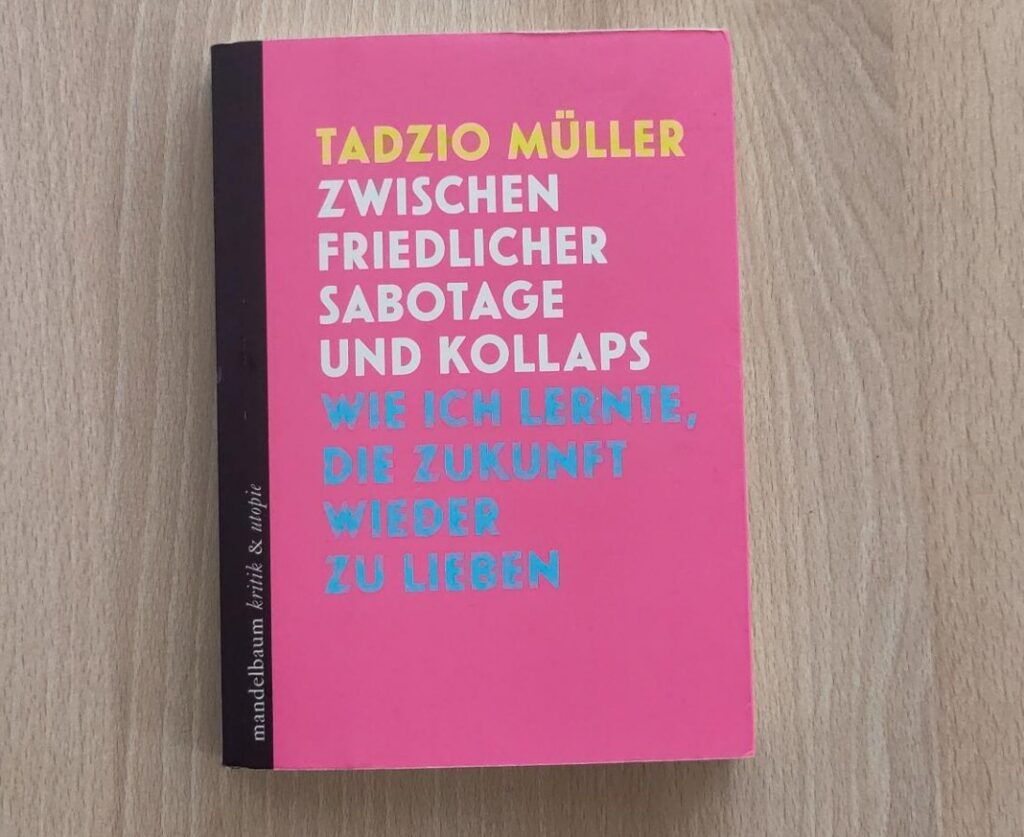
Tadzio Müller ist u.a. bekannt als ein Vordenker aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, in der er sich seit 2007 engagiert. Im Nachgang zum Besuch einer Buch-Lesung von ihm habe ich mir sein, 2024 erschienenes, Buch „Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps“ gekauft und inzwischen auch durchgelesen.
Ausgangspunkt seines Buchs ist eine Stimmung, die er als „Zukunftsdepression“ oder „Klimadepression“ bezeichnet. Diese durchlebt er sowohl als Individuum als auch mit großen Teilen der Bewegung.
Das bringt ihn nach einer Phase hedonistischen Eskapismus zu einer psychologischen Analyse des Verhältnisses von Klimagerechtigkeitsbewegung zur restlichen Bevölkerung, welche er als „das fossile Mehrheitsdeutschland“ bezeichnet.
Denn diese Mehrheitsgesellschaft ist eine „Verdrängungsgesellschaft“. Auf das nicht eingelöste Versprechen von nachhaltigen Klimaschutz werde von ihr mit Scham und Verdrängung reagiert. Diesen Konflikt analysiert er wie eine Beziehung:
„Der Klimakampf in Deutschland ist ein Beziehungskonflikt mit einem verdrängenden, beschämten, ängstlichen Akteur.“ (Seite 45)
Schuld und Scham unterscheidet er dabei wie folgt:
„Schuld sagt: Das war schlecht; Scham sagt: Du bist schlecht“ (Seite 198)
Sogar „Phasen der Klimatrauer“ identifiziert Müller.
Am Ende solle eine Akzeptanz des kommenden Kollaps stehen, um sich besser darauf vorzubereiten. Er zählt in diesem Zusammenhang drei unbequeme Wahrheiten auf:
* „Wahrheit Nr. 1: Der Klimakollaps hat begonnen“ (Seite 164)
* „Wahrheit Nr. 2: Die Bewegung für die Zukunft als Bewegung zur Verhinderung des Klimakollaps ist gescheitert“ (Seite 165)
* „Wahrheit Nr. 3: Im Faschismus ist alles nichts“ (Seite 166), damit meint er bei einer faschistischen Regierung würden sich „sich die Bedingungen jeder Art progressiven Aktivismus fundamental verschieben“ (Seite 167)
Doch viele verdrängen weiter. Selbst in der Szene der Klimagerechtigkeits-Bewegung sieht er Kollapsakzeptanz und Kollapsleugnung miteinander ringen. Erst recht in der Mehrheitsgesellschaft.
Um die Realität des Klimawandels zu verdrängen würden sich viele Menschen in ein immer irrationaleres Verhalten und eine „immer irrationalere Klimadebatte“ flüchten.
Damit verbunden sei die ökonomische „Externalisierungsgesellschaft“, also die Auslagerung der Folgen unserer Lebensweise, der imperialen Lebensrealität im Westen:
„Die ökonomisch positiven, wohlstandschaffenden Effekte der fossil-kapitalistischen Produktions- und unserer „imperialen Lebensweise“ haben ihr Gegenstück in ökonomisch negativen, wohlstands- und wohlfahrtszerstörenden Effekten in anderen, meist ärmeren, meist „südlicheren“ Teilen der Welt.“ (Seite 53)
Spätestens 2020 seit Klimagerechtigkeits-Bewegung in die Defensive geraten. Doch auch die Umfrage-Mehrheiten davor und der größere Zuspruch für das Thema, hätten nicht wirklich bedeutet handlungsfähig zu sein. Denn damals hätte eine harte Minderheit (blockierende Lobbys, Leugner*innen etc.) gegen eine weiche Mehrheit gestanden. Auch die dem Klimaschutz damals noch zuneigende Mehrheit sei nicht bereit gewesen tiefgreifende Veränderungen oder gar Nachteile mit zu tragen. Nur in der Theorie sei man für eine Veränderung, aber die Praxis werde eher abgelehnt. Das Prinzip lautete quasi „wasch mich aber mach mich nicht nass“. Er nennt das eine „Klimamehrheitsillusion“. Inzwischen stände sogar eine harte Mehrheit gegen die notwendige Transformation.
Er macht einen reaktionäre[n] „Anti-Veränderungs-Affekt“ aus:
„Das zeigt, dass dieser Anti-Veränderungs-Affekt kein politisch unschuldiger, sondern ein aktiv reaktionärer ist: War die Zukunft (bis zur Klimakrise) immer die Zeit der Linken, so war die imaginierte Vergangenheit immer die Provinz der Rechten.“ (Seite 180)
Interessant ist auch die Analyse und Binnen-Differenzierung der Klima-Bewegung von Müller. Er unterscheidet zwischen „Klimaradikalen“ und gemäßigteren Klimaschützer*innen. Letztere werden durch eine moderate Hegemonie von „Fridays for Future“ vertreten.
Er vergleicht dabei auch die Strategien von „Fridays“ und „Letzter Generation“
Obwohl er die Niederlage bereits 2020 verortet, geht Müller noch einmal auf die Ereignisse um Lützerath 2022/23 ein, die er trotz der Niederlage beim Kampf um das Dorf als symbolischen Sieg sieht. Diesen Sieg hatte er auch persönlich nötig gehabt, um aus seiner Polit-Depression heraus zu kommen.
Am Beispiel von der Auseinandersetzung von Lützerath erläutert er „Partei-elastische“ Strategien, d.h. die mit der eigenen Agenda adressierte Partei sei sekundär während die Bewegungsmacht entscheidend sei. Wenn die Partei die Ziele der Bewegung nicht umsetze, könne man sie abstrafen.
Interessanterweise widerspricht Müller als Kommunist der verkürzten ökonomischen Folie, durch die viele Linken die Auseinandersetzung zu dem Thema Klimagerechtigkeit betrachten. Der Feind, so Müller, sei nicht nur das Kapital, sondern auch die Arbeit, also das Job-Argument. Im Westen profitierten auch die Lohnabhängigen vom globalen Klima-Unrechts-Regime.
Von all dem ausgehend konstatiert Müller, dass sich ein Klimazusammenbruch nicht mehr aufhalten lassen wird. Er warnt allerdings vor zu apokalyptischen Szenarien, wie sie sicherlich auch Hollywood-Filme a la „The Day after Tomorrow“ in unsere Köpfe gepflanzt haben. Stattdessen definiert er den Kollaps folgendermaßen:
„Kollaps ist nicht, wenn alle tot sind; Kollaps ist, wenn es keine Selbstverständlichkeiten mehr gibt. Wenn Du nicht mehr zur Arbeit fahren kannst, weil Du keine Arbeit mehr hast oder Mobilität nicht mehr funktioniert. Kollaps ist, wenn Du nicht mehr einkaufen kannst, weil Du kein Geld mehr hast oder nix mehr in den Supermarktregalen legt. Kollaps ist, wenn sich Bürgerwehren gründen, um Gesetze und gemeinschaftliche Regeln durchzusetzen, weil der Staat nicht mehr in der Lage oder willens ist, diese auf seinem gesamten Territorium durch die Exekutive durchsetzen zu lassen.“ (Seite 296)
Nach dem Scheitern der Klimagerechtigkeits-Bewegung müssten neue Wege beschritten werden. Er plädiert für friedliche Sabotage auf „kritische Energie-Infrastruktur“ als Akte der Notwehr und für kollektives Preppen, d.h. die kollektive Vorbereitung auf Notsituationen. Er plädiert für eine aufsuchende Unterstützung in marginalisierten communities in Kollaps-Szenarien.
Obwohl es vor allem um den Umgang mit den Klimawandel geht betrachtet Müller auch den Rechtsruck, den er als eine Art „Coming Out“ der Rechten sieht. Er konstatiert eine Entwicklung von der Verdrängungs- zur Arschloch-Gesellschaft.
Menschen, die schon immer rechts oder reaktionär waren trauen sich nun einfach „schamfrei ein Arschloch“ zu sein. Bisher hätte dieser Bevölkerungsanteil ein Repräsentationsdefizit gehabt, was jetzt mit den entsprechenden Parteien und Politiker*innen aufgehoben sei.
Der Antifa-Bewegung bescheinigt er ebenso wie die Klimagerechtigkeitsbewegung gescheitert zu sein.
Kritik und Widerspruch
Ich gehe mit vielen mit, was der Autor in Bezug auf Erfolglosigkeit und Ignoranz konstatiert. Die kollektive Verdrängung ist sicherlich ein wichtiger Faktor, wobei ich das Scheitern der Klimagerechtigkeits-Bewegung nicht monokausal erklären würde.
Ich hätte folgende Punkte einer solidarischen Kritik:
1. Mir riecht die Schwerpunktsetzung auf Katastrophen-Hilfe a la kollektives Preppen zu sehr nach Feuerwehr-Politik. Ja, Linke müssen eine Strategie der politischen Minderheit entwickeln, weil politische Mehrheiten derzeit nicht erreichbar scheinen, jedenfalls nicht für die eigentlich notwendige gesellschaftliche Transformation. Natur-Katastrophen und politische Verschärfungen im Sinne einer Faschisierung müssen dabei zwingend mitgedacht werden.
Müller macht sich sehr für einen Ansatz des kollektiven Preppens stark. Doch was könnte bestenfalls bei diesen Ansatz raus kommen? Linke Strukturen, die die viel größeren und Ressourcen-reicheren Strukturen des Staats (Feuerwehr, THW, Armee, Polizei) unterstützen bzw. mit ihnen konkurrieren wollen? Klar, man kann durch die Hilfe und Unterstützung in Krisen-Situationen Ansehen und Respekt in der Bevölkerung gewinnen. Und dann? Zu lernen wie Stich- und Schusswunden (wie in Schweden in Folge von Ganggewalt) gestoppt werden ist sicherlich hilfreich, aber das allein als Praxis ist zu wenig. Es sollte einen Unterschied zwischen linker Bewegung und einer Volkshochschule geben. Wo liegt die Utopie in diesem Ansatz?
Es gibt einen Unterschied zwischen der Aufgabe eines gesamtgesellschaftlichen Anspruchs und der Einplanung und Einschätzung der eigene Schwäche und kommender Krisen.
2. Solidarisches Preppen macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn es um eine Überbrückungszeit geht. Wenn der Strom für drei Tage ausfällt, dann kann man helfen. Fällt er dagegen für immer aus, dann ist das ein Zivilisationszerfall und soviel Notvorräte etc. gibt es gar nicht, um das dauerhaft gut durchzustehen. Dann geht es nicht mehr um Hilfe in der Katastrophe, sondern um deren Verwaltung.
3. Ersatz-Strukturen für den Notfall sind oft prekär und können von den Ressourcen her, zumindest in Deutschland, nicht dauerhaft den Staat ersetzen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Dokumentation über die Bürgerkliniken, die in Griechenland während der Finanz-Krise entstanden sind. Die waren sehr von Medikamenten-Spenden aus dem Ausland abhängig. Insgesamt schien mir das ein nur sehr prekärer Ersatz staatlicher Strukturen zu sein.
4. Die Klimakrise ist schon da und wird immense Auswirkungen haben, aber es muss einen weiteren politischen Kampf darum geben wie groß sie genau ausfallen wird. Es gibt auch Modelle, die mit einer möglichen Klimaerwärmung von 5 Grad arbeiten, wodurch große Teile der Erde fast unbewohnbar werden würden. Das muss verhindert werden. Jetzt nach einer Niederlage den politischen Kampf aufzugeben heißt auch diese Möglichkeit wahrscheinlicher werden zu lassen.
5. Es empfiehlt sich im Gegensatz zu Müllers Ratschlag als Klimabewegung auch deswegen weiterhin sichtbar aufzutreten, weil die Möglichkeit besteht dass bei einer spürbaren Verschlechterung durch Klima-Katastrophen sich viele daran erinnern könnten, dass da eine Bewegung ist/war, die schon vor Jahren davor warnte.
6. Mir fehlt eine grundsätzliche Staatskritik. Die politischen Voraussetzungen für das Entstehen von Bewegungen und Parteien sind sehr unterschiedlich. Müller zieht seine Analyse offenbar aus seinen Beobachtungen in der Bundesrepublik und de Westen. Was er kaum thematisiert ist die hinderliche Einteilung der Welt in Staaten bzw. Volkswirtschaften, die ständig miteinander konkurrieren und zum Teil auch autoritäre Regierungen haben, die durch Bürger*innen-Bewegungen und Wahlen nicht erreicht werden bzw. die solche Bewegungen schon von Anfang an verhindern.
7. Die Naturkatastrophen werden nicht überall gleichförmig ablaufen und ein hoher Ressourcen-Zugang wird helfen sie auszubremsen bzw. die Folgen zum Teil abzumildern. Der Westen mit seinen Ressourcen wird sie besser bewältigen als ärmere Staaten. Im schlimmsten Fall werden Teile der Krise outgesourct werden. Im Westen werden die Dämme und Deiche höher gelegt werden, weil man es sich leisten kann, dafür wird dann vielleicht mehr im globalen Süden überschwemmt. Auch die Rohstoffe für die Krisenbewältigung könnte man weiter aus dem Süden ’nehmen‘, bis hin zu Wasser und Sand.
Neben einem internationalen outsourcing der Krisenfolgen könnte das zum Teil auch national geschehen. Der Staat zieht sich aus Brennpunkt-Vierteln oder Teilen des ländlichen Raums zurück. Die Mittel- und Oberschicht mauert sich in gated communities ein.
8. Viele Menschen im Westen könnte eine fatalistische Kollapsakzeptanz zu einer individualistischen statt zu einer kollektiven Lösungsstrategie verführen. Für Angehörige der Mittel- Oberschichten macht es strategisch durchaus Sinn ihre Ressourcen für sich und ihre Familien zu reservieren um kommende Krisen besser überstehen zu können. Der kollektive Ansatz im Sinne einer positiven Gesellschaftsveränderung ist ja anscheinend ohnehin gescheitert.
9. Mir ist der Rahmen von Müllers Diagnose des Scheiterns nicht klar. Die Klimagerechtigkeitsbewegung war ja eher eine westliche Bewegung in den Metropolen.
Im globalen Süden gab und gibt es andere wichtige Bewegungen, z.B. den arabischen Frühling – wobei der auch gescheitert ist.
Ich könnte mir vorstellen dass im Süden unabhängig von den westlichen Metropolen eine eigene kraftvolle ökologische Bewegung entsteht oder gerade im Entstehen ist.
Hier sind auch die Mittelschichten wesentlich schlechter abgesichert und deswegen vielleicht weniger durch eine Besitzstandswahrung gebunden.
10. Dass das coming out der Arschlochgesellschaft ist nicht so offen wie Müller es darstellt. Das Ausleben von „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ unterliegt immer noch einem gewissen Rationalisierungsdruck. Oder anders ausgedrückt: die Forderung „Ausländer raus!“ muss immer noch als „Kriminelle Ausländer raus!“ verkauft werden. Es ist oft eher ein verdruckster Faschismus. Das outing scheint noch nicht vollständig abgeschlossen zu sein.
11. Als schwuler Kommunist ist bei Müller der wütende Dualismus Arschlöcher – Gute sicherlich sehr nachvollziehbar. Es verhindert aber eine Differenzierung, die für eine Analyse notwendig ist und um Strategien zu entwickeln wie man die Nicht-ganz-so-Arschlöcher eventuell zurück gewinnt.
12. Bei seiner Parallele zur deutschen Nachkriegsgesellschaft und deren Scham weiß ich nicht ob das so stimmt. Das würde ja bedeuten dass die Täter-Generation überhaupt gewusst hätte, dass sie etwas Falsches getan hat. Viele NS-Mörder haben auch nach 1945 recht offen über ihre Taten gesprochen. Da war nur wenig von Scham zu erkennen. Die kam erst in den nachfolgenden Generationen zum Vorschein. Stichwort: „Opa war kein Nazi!“
13. Der Autor warnte davor, dass die Rechten sich der Ängste in der Bevölkerung annehmen würden. Ich würde aber sagen dass Rechte vor allem auch rechte Ängste bearbeiten und die sind höchst irrational. Da geht es eben nicht um Klimawandel oder Artensterben, sondern um „Überfremdung“ oder „Rassenkriege“, „Verschwulung“ oder die finstere Mächte wie die „Zionisten“ oder George Soros im Hintergrund. Höchstens könnte man noch argumentieren, dass die unbewussten realen Ängste auf irrationale Ängste übertragen werden.
14. Wie viele Mitglieder außerparlamentarischer Bewegungen unterschätzt er die Staatsgewalt. Er empfiehlt Resilienz gegen rechte Regierungen aufzubauen. Doch eine Resilienz gegen faschistische Staatsgewalt gibt es in letzter Instanz nicht. Besonders mit den heutigen technischen Möglichkeiten.
15. Müller führt die Verärgerung der Autofahrer*innen gegenüber den Blockaden von der „Letzten Generation“ automatisch auf Scham zurück, weil sie zwar um das Problem des Klimawandels wissen, aber nichts dagegen tun. Das überzeugt nicht so recht, denn es ist dieselbe Verärgerung in der Bevölkerung wie bei Streiks (z.B. der Bahn) bei denen die Streikenden und nicht der Grund des Streiks verantwortlich gemacht werden. Ich würde viel eher einen internalisierten Arbeitsfetisch verantwortlich machen.
16. An einer Stelle im Buch setzt Müller die Arbeiter*innenbewegung im Kaiserreich und Klimagerechtigkeitsbewegung gleich.
Tatsächlich war die Arbeiter*innenbewegung damals aber weitaus größer und durchdrang viel intensiver ihre Angehörigen. Sie war eine eigene Kultur mit eigenen Zeitungen, Treffpunkten und Vereinen vom Sport- bis zum Begräbnis-Verein. Daran kommt die Klima-Bewegung, deren organisierender Teil im Kern in Deutschland aus ein paar tausend Personen besteht, nicht einmal ansatzweise heran.
Trotz dieser ausführlichen Kritik ist das Buch von Tadzio Müller ein wertvoller Debatten-Beitrag.
Das Buch ist in einem persönlichen Stil verfasst. Manche spricht so etwas an, mich hat es eher angestrengt. Das ist aber Geschmackssache.
Tadzio Müller: Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps, 2024