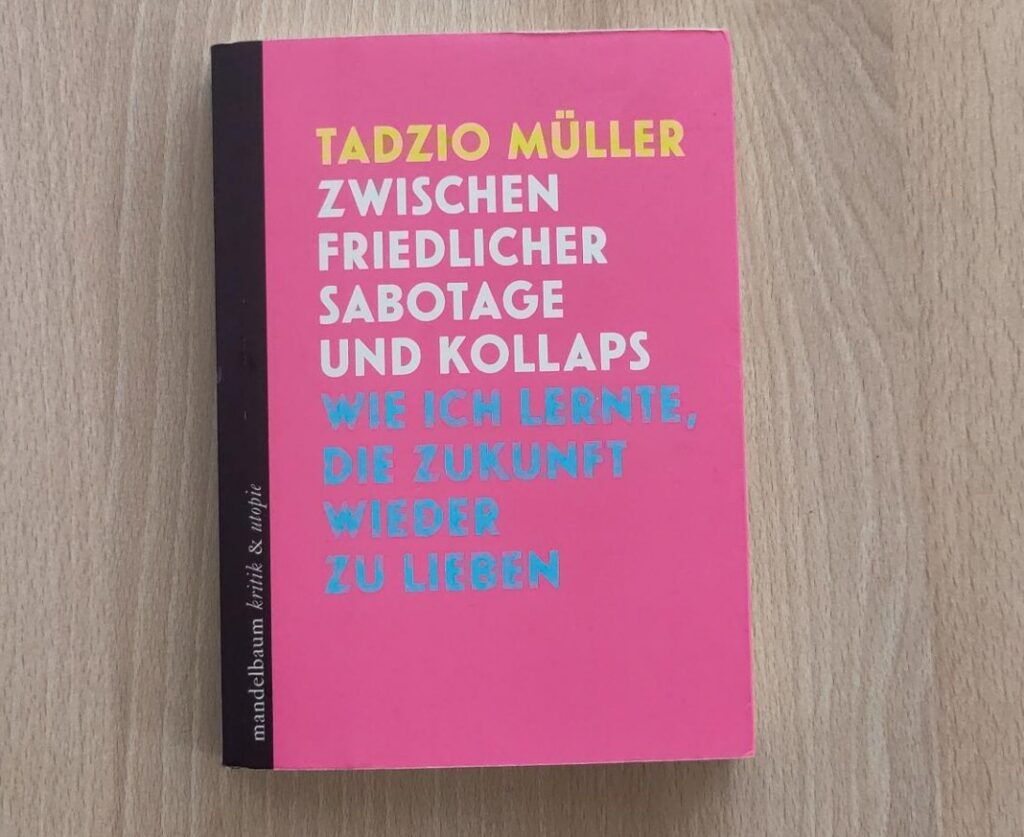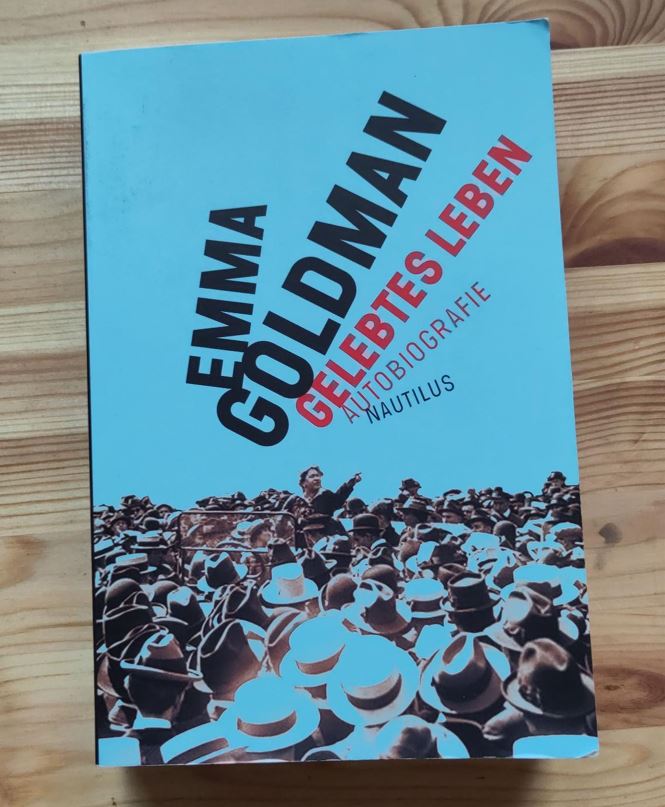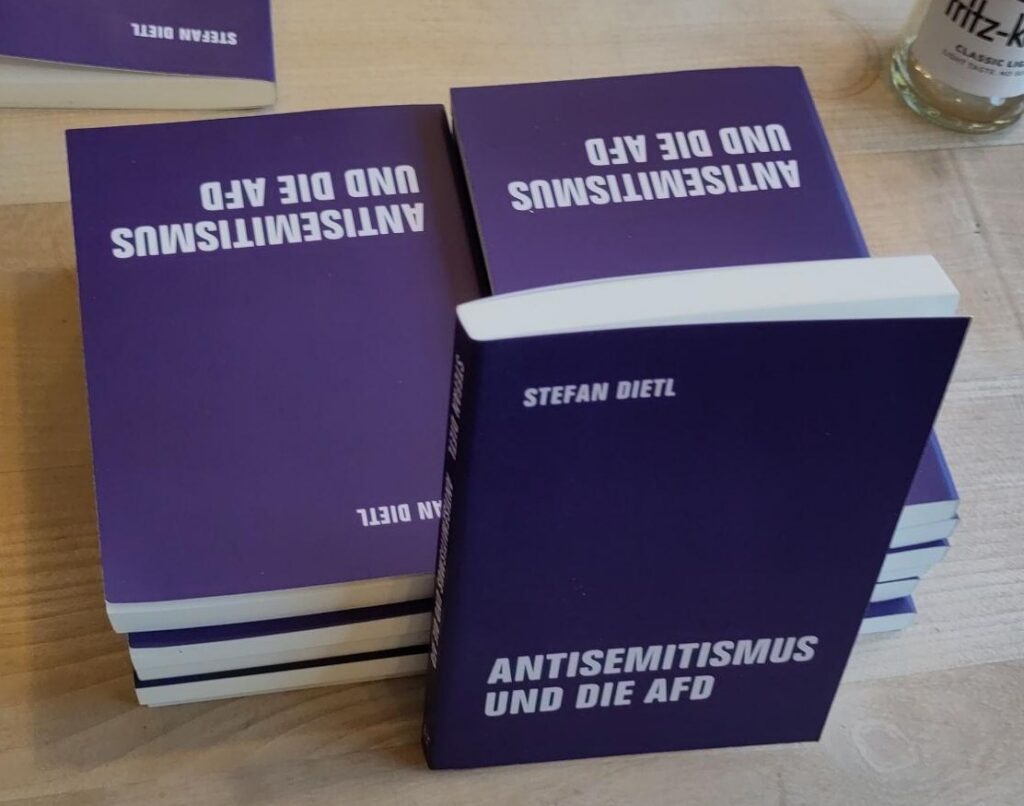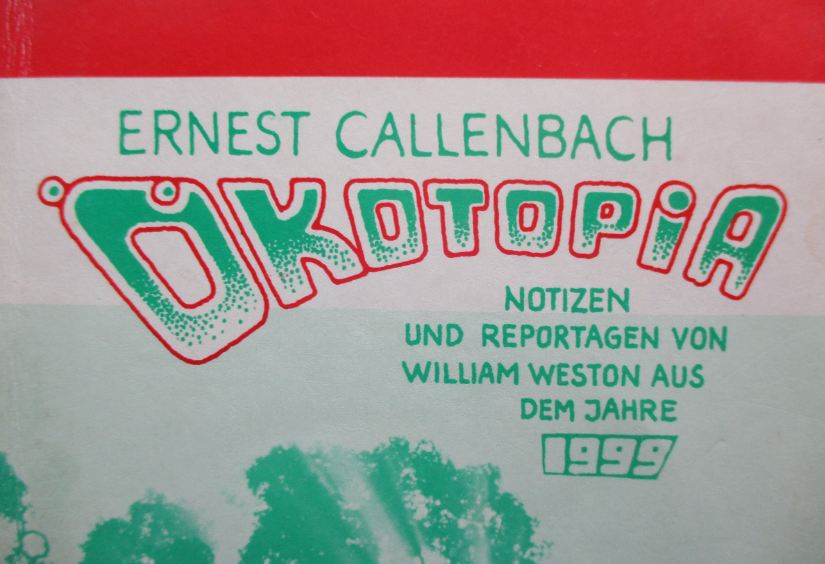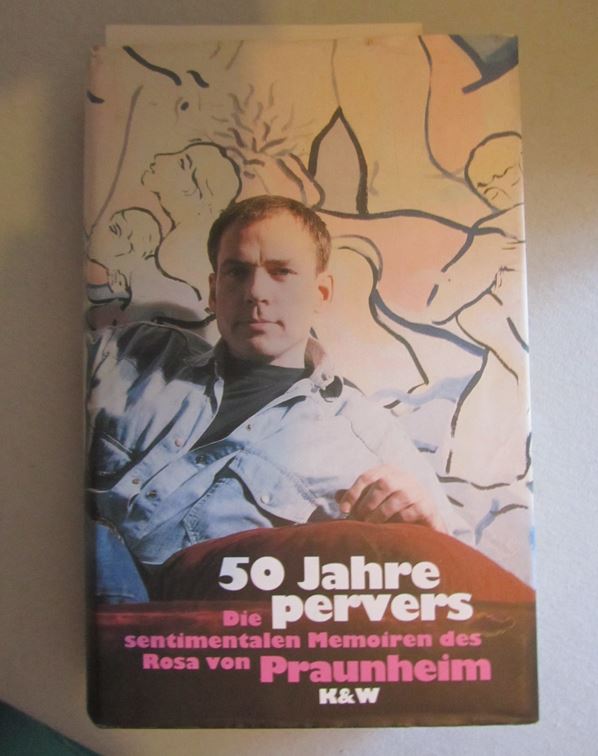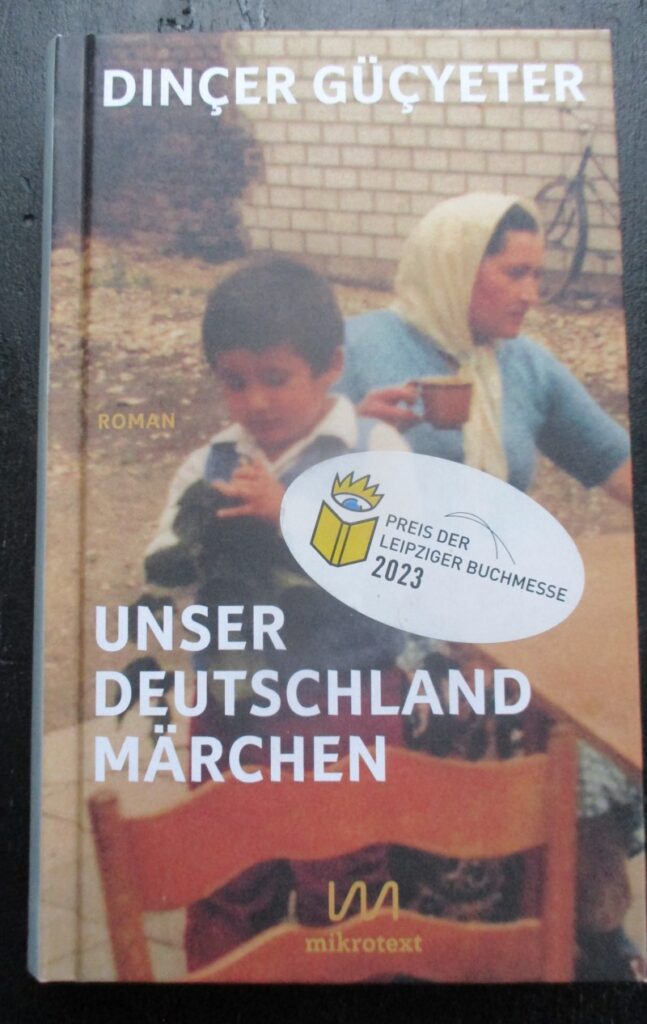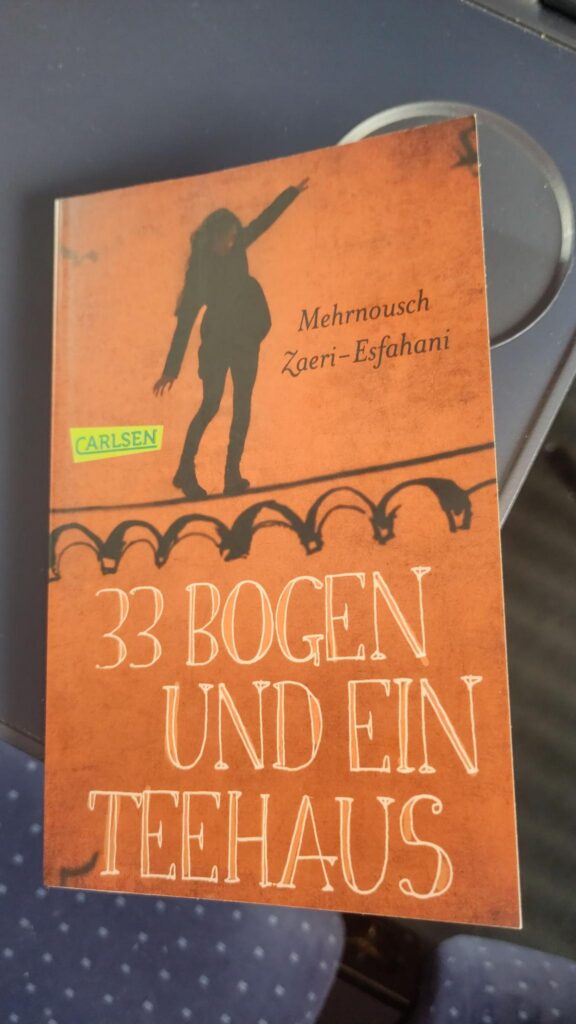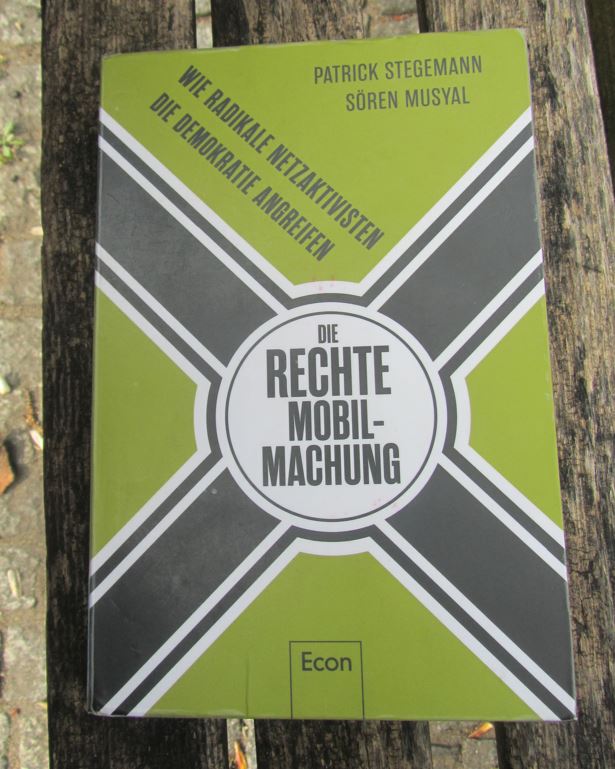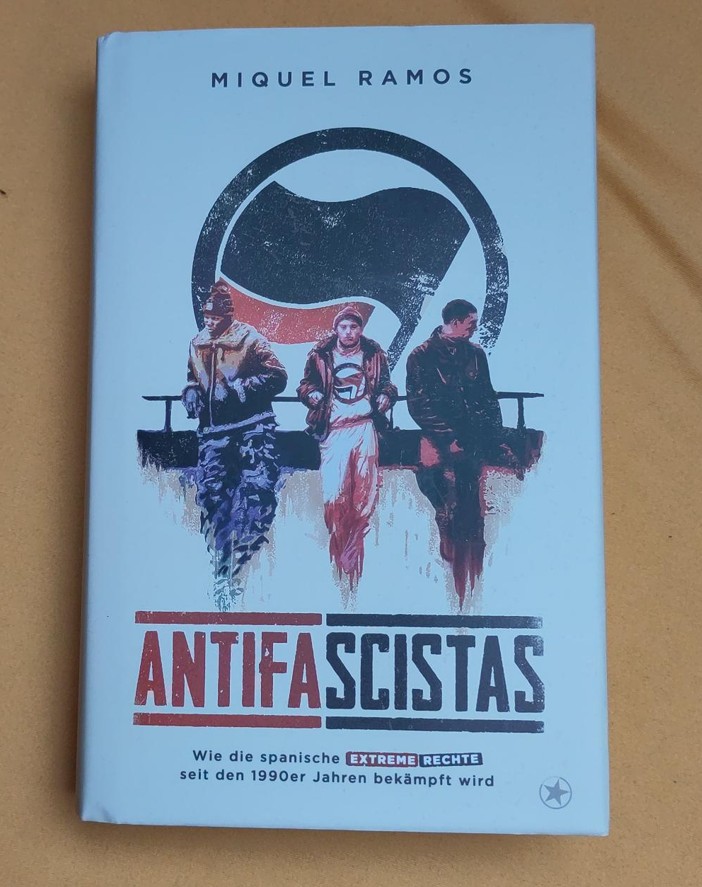
Mehr als 500 Seite dick ist das Buch „Antifascistas“ von Miquel Ramos, welches sich dem Thema „Wie die spanische extreme Rechte seit den 1990er-Jahren bekämpft wird“ widmet. Im spanischen Original ist es 2022 erschienen und 2024 erschien bei „Bahoe Books“ (Wien) die deutsche Übersetzung als überarbeitete Version.
Ramos porträtiert für die vier Jahrzehnte von 1982 bis 2022 sowohl die extreme Rechte als auch ihren antifaschistischen Gegenspieler. Er selber schreibt über die von ihm dargestellte antifaschistische Bewegung als einem „Generationsportrait“.
Wichtig für Leser*innen außerhalb Spaniens ist es zu wissen, dass 1975 mit dem Tod des Diktators Franco in Spanien eine Übergangszeit, die so genannte Transición, begann die bis 1982 andauerte. Die Transición forderte laut Ramos 178 Todesopfer durch franquistische Polizei-Gewalt und 67 durch extrem rechte Gewalt. Das Ende des Franco-Faschismus verlief somit entgegen anderslautender Mythen nicht unblutig. Alle Spielarten der extremen Rechten in Spanien nach 1982 stellten sozusagen einen Post-Franco-Faschismus dar, wenn auch nicht alle immer ideologisch einen starken Franco-Bezug aufwiesen. Der Ausgang der von Ramos skizzierten Entwicklungen in einer jungen Post-Diktatur-Republik sollte immer mitgedacht werden, um die Verhältnisse und Entwicklungen nachzuvollziehen. Dabei kam es im postfranquistischen Spanien, ähnlich wie in den beiden postnazistischen deutschen Staaten BRD und DDR zu keiner echten juristischen und gesellschaftlichen Aufarbeitung der Diktatur – auch wenn es in der DDR zu mehr Prozessen gegen NS-Täter kam.
Die extreme Rechte in Spanien nach der Franco-Diktatur
Die extreme Rechte in Spanien blieb anfangs stark im spanischen Nationalkatholizismus verwurzelt, der auch die ideologische Basis der Franco-Diktatur darstellte. Viele extreme Rechte der 1980er und 1990er Jahre waren Franco-Nostalgiker*innen.
Doch, auch durch Impulse aus dem Ausland, entwickelten sich neue Ansätze, Organisierungen und ideologische Strömungen der extremen Rechten. Etwa eine nationalrevolutionäre Rechte oder eine Neue Rechte. Die Neue Rechte hatten es im Gegensatz zu anderen Ländern schwer in Spanien: „Das Gewicht des Katholizismus und der noch immer austretende Eiter des Franquismus ließen keinen Raum für [neurechte] Experimente.“ (Seite 305)
Organisatorisch tauchten neue Parteien, Gruppen und Subkulturen auf. Mit der Skinhead-Subkultur hielten auch extrem rechte Skins, so genannte Boneheads, Einzug in Spanien.
Als wichtigen nazistischen Impulsgeber beschreibt der Autor den „Círculo Español de Amigos de Europa“ (CEDADE; Deutsch: „Spanischer Zirkel der Freunde Europas“), der noch unter Franco 1966 gegründet wurde. Der CEDADE war orthodox-hitleristisch ausgerichtet und 30 Jahre aktiv.
Am Rande wird im Buch erwähnt dass Saudi-Arabien CECADE für die Herausgabe von antisemitischer Literatur bezahlte.
Neben einem Neo-Franco-Faschismus verbreitet sich durch Organisationen wie CECADE auch ein Neonazismus in Spanien. Der Autor schreibt von einem „intellektuelle[n] Nationalsozialismus abseits der Straßengangs“.
In Spanien bildeten sich auch Ableger von internationalen Neonazi-Netzwerke. Blood&Honour wurde in Spanien 1999 als Verein angemeldet und die Hammerskins gründeten 2000 in Spanien einen Ableger. Allerdings zerschlug die Polizei 2004 und 2005 Blood&Honour und die Hammerskins.
Ausländische Impulsgeber waren „Casa Pound“ aus Italien oder die „Goldene Morgenröte“ aus Griechenland.
Im Parlament band lange Zeit die rechtskonservative, postfranquistische „Partido Popular“ (PP) die meisten rechten Wähler*innen und Franco-Fans. Es gab zwar extrem rechte Parteien, aber diese blieben lange Zeit erfolglos. Es dominierten kleine, sehr zerstrittene Neo-Falange-Parteien in der parlamentarischen extremen Rechten. Die erste extrem rechte Partei ohne Franco-Bezug in Spanien wurde mit der „Democracia Nacional“ (DN) erst 1995 gegründet. Sie war neonazistisch, trat aber eher nationalpopulistisch auf.
Besonders erfolgreich war die DN bei Wahlen jedoch nicht. Das etwa ein Dutzend extrem rechter Parteien lag in Spanien lange Zeit nur bei 1% der Stimmen. Erst 2011 tauchte mit der „Plataforma per Catalunya“ eine regional erfolgreichere extrem rechte Partei auf. Auf nationaler Ebene gelang es erst mit der Partei VOX, de facto eine Abspaltung von der konservativen PP, ab 2018 eine ernsthafte Konkurrenz von rechts zur PP darzustellen.
Dabei wendete die Partei, wie Ramos beschreibt, immer wieder das rechtspopulistische Prinzip der Provokation an, um Medien-Aufmerksamkeit zu erringen.
Vor dem Aufstieg von VOX ging die Gefahr vor allem vom außerparlamentarische Neofaschismus und seiner Gewalt aus. Die extreme Rechte war stark mit der Fußballfanszene einzelner Mannschaften verwoben. Stadien dienten lange als Rekrutierungsort des Straßenfaschismus. Ramos schreibt: „Die Tribünen der Ultras wurden in einem Großteil Spaniens von der extremen Rechten übernommen, wenn auch mit ehrenwerten Ausnahmen.“ (Seite 74)
Auch die Verbindungen der extremen Rechten zwischen Spanien und Deutschland werden von ihm nachgezeichnet. Das fängt bei den Altnazis an, die ab 1944/45 nach Franco-Spanien ausgewandert oder geflüchtet sind. Bis hin zu Auftritten bekannter deutscher Neonazis wie etwa Manfred Roeder (1929-2014) im Jahr 2010 im „Buchladen Europa“ oder dem NPD-Politiker Udo Voigt (1952-2025).
Umgekehrt nahmen spanische Neonazis an den Gedenkmärschen für den Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess im bayrischen Wunsiedel teil.
Der gewalttätige Straßen-Neofaschismus führte von 1990 bis 2022 zu über 100 nachgewiesenen Todesopfer rechter Gewalt. Viele Fälle und ihre Auswirkungen dokumentiert Ramos in seinem Buch aber auch auf der Seite crimenesdeodio.info.
Nicht wenige Opfer rechter Gewalt in Spanien gehörten marginalisierten Randgruppen wie Prostituierten, Transpersonen oder Obdachlosen an. Auch in Spanien gab es Baseballschlägerjahre mit einem Schwerpunkt in den 1990-er Jahren. Allerdings bekommt bei der Lektüre des Buches den Eindruck das der Höhepunkt der Baseballballschlägerjahre in Spanien bis in die 2000-er Jahre hinein reichte.
Wie in Deutschland z.B. in Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda so gab es auch in Spanien rassistische Pogrome aus der Bevölkerung heraus. Ramos beschreibt in seinem Buch ein mehrtägiges Pogrom 1999 in Terrassa (Provinz Barcelona) gegen Magrebhiner*innen, bei dem ein Mensch getötet wurde, und ein Pogrom im Februar 2000 in El Ejido.
Als eine Zäsur für die antifaschistische Bewegung in Spanien wird im Buch der Mord an dem 16-jährigen Antifaschisten Carlos Palomino am 11. November 2007 in Madrid beschrieben. Carlos wurde in der Bahn auf dem Weg zu einer Antifa-Demonstration von dem 25-jährigen Berufssoldaten Josué Estébanez brutal mit einem Messer ermordet.
Wichtige allgemeine politische Zäsuren in Spanien waren die Wirtschaftskrise 2008, die Spanien weitaus härter traf als die Bundesrepublik, die Proteste 2011/2012 („Movimiento 15-M“ oder „Indignados“), das Auftauchen der zeitweilig erfolgreichen linken Protestpartei „Podemos“ oder das Unabhängigkeits-Referendum in Katalonien im Oktober 2017.
Antifaschistische Abwehrkräfte
In den 1980er-Jahren entstanden aus purer Notwehr die ersten Antifa-Gruppen in Spanien. Oft wurde mit militanter Gegenwehr auf den aufkommenden Straßenfaschismus reagiert.
Doch so richtig entwickelte sich der Antifaschismus in Spanien erst seit Beginn der 1990er Jahre: „Die erste Hälfte der 1990er Jahre war geprägt von der Gewalt der extremen Rechten und dem Entstehen der ersten antifaschistischen Kollektive und Plattformen als Reaktion darauf.“ (Seite 131)
Ramos sieht den Antifaschismus als soziale Bewegung. Diese Bewegung suchte schon früh Bündnisse mit anderen Bewegungen oder Minderheiten, etwa Migrant*innen oder Gitanos, also spanischen Roma. Sein Buch ist auch eine Darstellung der außerparlamentarischen Linken und sozialen Bewegungen in Spanien. Diese Darstellung ist empathisch und parteiisch, weil Ramos zwar Journalist ist, aber gleichzeitig auch Aktivist und das – sympathischerweise – nicht verleugnet. Es geht zum Beispiel auch um die Hausbesetzer*innen-Bewegung und die damit verknüpfte Bewegung der sozialen Zentren.
Der Autor macht in seinem Buch zudem unsichtbare Geschichte sichtbar, etwa wenn er über die Schwarze Jugendgruppe „Color Power“ schreibt.
Neben der Bündnis-Politik beschreibt er die verschiedenen Mittel der antifaschistischen Bewegung im Kampf mit der extremen Rechten. Dabei geht es nicht nur um Militanz, sondern auch um Aufklärung, Recherche oder Bündnis-Politik. Musik spielte ebenfalls im Antifaschismus eine wichtige Rolle, wie Ramos in dem Kapitel „Musik als antifaschistisches Werkzeug“ ausführt.
In der außerparlamentarischen Linken Spaniens kam es zu ähnlichen Diskursen wie in der außerparlamentarischen Linken in der Bundesrepublik. Die Kritik am Szene-Machismus und -Sexismus. Die Kritik am Rückzug in eine linke Subkultur. Die Kritik an der fehlenden Sichtbarkeit von Migrant*innen in linken, ja sogar in antirassistischen Gruppen. Oder der Streit zwischen einem bürgerlichen und einem linksradikalen Antifaschismus.
Auch das der Autor über extrem rechte Chats bei Polizei und Armee berichtet, dürfte vielen hierzulande bekannt vorkommen.
Es gibt viele Analogien zu den Entwicklungen in anderen westlichen Ländern aber auch wichtige Unterschiede. Die politische Kultur in Spanien weist starke Eigenheiten auf. Diese resultieren auch aus dem Verhältnis zwischen dem spanischen Zentralstaat und starken Autonomie- und Unabhängigkeitsbewegung im Baskenland, in Galizien und in Katalonien.
So ist ein antikatalanisches oder ein antibaskisches Ressentiment sehr bestimmend im spanischen Nationalismus.
Einen breiten Raum im Buch nimmt die staatliche Repression gegen Linke, besonders gegen Antifaschist*innen ein. Diese ist oft sehr hart, während die extreme Rechte nicht selten verschont wurden. Letzteres verwundert kaum, da ja es ja diverse personelle Kontinuitäten der Franco-Diktatur in den Behörden gegeben haben muss. Unter dem Mantra „Alles ist ETA“ wurden Linke, auch nicht-baskische Linke, mit Staatsrepression überzogen. Absurderweise werden Antifaschist*innen in Spanien manchmal wegen „ideologischer Diskriminierung“ gegen Neonazis angeklagt. Eigentlich handelt es sich bei diesem Straftatbestand um ein Gesetz gegen Hassverbrechen gegen Minderheiten.
Da es sehr viele Repressions-Fälle gab, stellt das Buch über weite Strecken eine Repressions-Chronik dar.
Neben der Polizei und Justiz behandelt das Buch auch die Medien an vielen Stellen kritisch. Diese stellen oft rechte Angriffe oder die militante Abwehr der extremen Rechten als Konflikt von „rivalisierende Banden“ oder einfach als „Jugendgewalt“ dar: „Doch anstatt auf neonazistische Gewalt zu reagieren, verstärkten diese [Behörden und Medien] das Narrativ der Subkulturen, Jugendbanden und »Extremisten«. Ein Narrativ, das auch heute noch üblich ist, wenn es zu einer Konfrontation mit der extremen Rechten kommt, selbst wenn diese friedlich verläuft.“ (Seite 159)
Ähnlich wie in der Bundesrepublik gab es also auch in Spanien eine im Diskurs stark vertretene Extremismus-Theorie.
Das Buch enthält spannenden Details etwa, dass es im sozialen Zentrum „L’Obrera“ in Valencia ein „Rukeli-Fitnessstudio“ gibt, benannt nach dem deutschen Sinto-Boxer Johann ‚Rukeli‘ Trollmann. Oder man erfährt dass es auf den Kanarischen Inseln elf anarchistisch inspirierte, selbst verwaltete „Gemeinschaften des Widerstands“ gibt, in denen mehr als 1.000 Menschen leben.
Fazit: spannende linke Bewegungsgeschichte
Für Leser*innen der deutschen Ausgabe der Vergleich mit der Bundesrepublik besonders spannend und Erkenntnis-versprechend. Welche Entwicklungen verliefen anders, welche parallel und welche geschahen zeitversetzt?
Das Buch ist in gewisser Weise voraussetzungsvoll, auch wenn sich am Ende ein Register für Personen und Gruppen findet. Viele Leser*innen im Ausland haben nicht das Wissen über die politische Kultur und Geschichte in Spanien. Etwa über die verschiedenen Regionalismen und Separatismen in Spanien, die meist linksnationalistisch und antifranquistisch ausgerichtet sind. So spielt der Konflikt im Baskenland auch außerhalb dieser Region immer wieder eine Rolle.
Wer in Deutschland weiß schon dass die sozialdemokratische Regierung ein Todesschwadron namens „Grupos Antiterroristas de Liberación“ (GAL) auf echte und vermeintliche ETA-Mitglieder losließ?
Obwohl VOX eine landesweit erfolgreiche extrem rechte Partei wurde findet sie relativ wenig Erwähnung im Buch. Der Autor verweist auf andere Bücher mit diesem Schwerpunkt. Trotzdem hätte man gerne mehr gelesen zum Umgang der antifaschistischen Bewegung in Spanien mit diesem Phänomen.
Auffällig ist ebenfalls dass Ramos wenig über einen Austausch mit der übrigen spanischsprachigen Welt berichtet. Schien er ihm nicht so relevant?
Natürlich, muss noch einmal betont werden dass das Buch von der antifaschistischen Bewegung handelt und kein Buch ausschließlich über die extreme Rechte in Spanien ist, auch wenn dieses Thema einen breiten Raum einnimmt.
Die extreme Rechte wird nur auf organisatorischer Ebene behandelt, wenig auf der Einstellungsebene (Verbreitung von Ressentiments in der Bevölkerung) und fast gar nicht auf einer theoretischen Ebene, in der versucht wird ihre Konjunkturen und Resonanzen zu analysieren.
Der Autor schildert viele Übergriffe und porträtiert die Betroffenen und die Täter*innen. Damit gibt er diesen Fällen einigen Raum im Buch. Offenkundig sieht sich Ramos in einer Chronisten-Pflicht. Allerdings wird das Buch dadurch sehr Chronologie-artig, für eine*n Leser*in im Ausland, dem/der die meisten Fälle und viele Tatorte nichts sagen, wird es deswegen etwas langatmig und verliert an Analyse-Fähigkeit. Wenn ständig Übergriffe durch die extremen Rechten und die Repression durch die Polizei geschildert werden, ist unklar wann der quantitative Höhepunkt war. Durch die Detailfülle ist es manchmal schwer die Etappen und Zäsuren zu erkennen.
Da das Buch ein gewisses Wissen voraus setzt, ist es nur Menschen mit diesem Vorwissen oder sehr starken Interesse an der antifaschistischen Bewegung in Spanien zur Lektüre zu empfehlen. Aber für diesen Kreis lohnt es sich, auch weil man durch die Rück-Vergleiche zur Bundesrepublik vieles deutlicher sieht und vielleicht versteht.
Miquel Ramos: Antifascistas. Wie die spanische extreme Rechte seit den 1990er-Jahren bekämpft wird, Wien 2025